6. Schußwaffengebrauch und Bandenkriminalität
Fast täglich kann man in den Vorabend- und Abendprogrammen der verschiedensten Fernsehanstalten Filme sehen, die
in Banden agierenden Drogenhändler zeigen, die mit teuren Autos schwer bewaffnet schießwütig in den Vororten der Großstädte ihr
Unwesen treiben. Diese Bilder prägten über die Jahre hinweg die Vorstellungen der meisten Bürger, die sie von Drogenhändlern haben.
Die Realität sieht in Deutschland jedoch sehr anders aus und hat mit den in den Fernsehfilmen vermittelten reißerischen Bildern überhaupt
nichts zu tun.
6.1. Schußwaffengebrauch
Die Daten der polizeilichen Kriminalitätsstatistik sind für die Jahre ab 1987 vollständig auf der Website des Bundeskriminalamtes
veröffentlicht. In der Tabelle 1 sind dort bei jeder Schlüsselzahl (Straftaten mit Angabe zu den entsprechenden §§ in den Gesetzestexten)
in zwei Spalten jeweils angezeigt, in wie vielen Fällen im Zusammenhang mit dieser Straftat mit einer Schußwaffe gedroht wurde oder
auch geschossen wurde. Bei den für diesen Zeitraum von 16 Jahren 2.588.765 aufgelisteten Delikte wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz (
einfache Verstöße, Handel und Schmuggel, Einfuhr von "nicht geringen Mengen", Anbau, Herstellung, Bereitstellung von Geldmitteln, und
so weiter) findet man einen einzigen Eintrag außer Null im Jahre 1995. In allen anderen Jahren registrierte die Polizei in Deutschland
kein Delikt im Zusammenhang mit Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, bei dem nachweislich mit einer Schußwaffe gedroht wurde
oder gar geschossen wurde.
Auch im Jahr 1995 wurde nicht geschossen, sondern im Zusammenhang mit der Abgabe, Verabreichung oder Überlassung
von Betäubungsmitteln an Minderjährige in zwei Fällen mit einer Schußwaffe gedroht. Das heißt statistisch gesehen, daß in den letzten
16 Jahren in 0,000 077% aller Fälle oder in weniger als einem Fall pro Million erfaßter Delikte mit der Schußwaffe gedroht wurde und
in 0,000% der Fälle oder in keinem einzigen Fall bei mehr als 2,5 Millionen erfaßten Delikte von der Schußwaffe Gebrauch gemacht wurde
und dabei geschossen wurde.
Zum Vergleich: In Deutschland wird jährlich in etwa 18.000 Fällen bei Straftaten eine Schußwaffe eingesetzt, wobei
in 12.000 Fällen "nur" mit der Schußwaffe gedroht wird und in 6.000 Fällen auch von der Schußwaffe Gebrauch gemacht und geschossen
wird.
Die schlimmsten Verbrechen (Mord und Totschlag) geschehen übrigens mehrheitlich innerhalb der Verwandtschaft und
im engeren Bekanntenkreis. Im Jahr 2002 wurden beispielsweise 412 Frauen und Mädchen in Deutschland ermordet oder totgeschlagen.
52,4% der Täter oder Tatverdächtigen waren Verwandte (direkte Familienangehörige oder Verlobte, Verschwägerte, Geschiedene, Pflegeeltern
oder -kinder) und 28,9% waren Bekannte, insgesamt stammten also 81,3% der Täter aus dem aller nächsten oder nahen Umfeld der Opfer.
Männliche Opfer eines Mordes oder Totschlages wurden 543 Personen im Jahr 2002 in Deutschland. Hier stammten 25,4% der Täter aus der
Verwandtschaft und 33,1% aus dem näheren Bekanntenkreis, insgesamt also 58,5% aus dem nahen oder näheren Umfeld des Opfers. In diesen
Zahlen sind die Opfer von versuchten (und mißlungenen) Mordanschlägen und versuchten Totschlägen nicht enthalten. 649 Frauen und 1.352
Männer, insgesamt also 2.001 Personen, waren letztes Jahr Opfer eines versuchten Mordes oder Totschlages. Bei über 40% der Totschlagdelikte
handelten die Täter unter Alkoholeinfluß.
Gemäß Statistik des Bundeskriminalamtes können also Drogenhändler in Deutschland nicht zu den gewalttätigen Personenkreise
gezählt werden, die mit Pistolen und Revolver ihre Kontrahenten einfach niederschießen. Im Umfeld der Beschaffungskriminalität zur
Beschaffung von Geldmitteln zum Erwerb von Betäubungsmitteln werden jedoch mehr Gewaltdelikte registriert als im Umfeld "gewöhnlicher"
Kriminalität. Die Beschaffungskriminalität wird jedoch nicht mit den Mitteln der Repression, sondern mit Substitutionsprogrammen
und Originalstoffvergabe am besten eingedämmt und bekämpft.
6.2. Bandenkriminalität
In den Medien konnte man jahrelang immer wieder von der zunehmenden "organisierten Kriminalität" im Zusammenhang
mit Betäubungsmitteln lesen und/oder hören. Auch wurde die sogenannte Bandenkriminalität immer wieder hervorgehoben.
Im Betäubungsmittelgesetz werden diejenigen, die innerhalb einer Bande agieren, mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei
Jahren bedroht, in minder schweren Fällen ist eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren anzusetzen. Gemäß § 30 Abs.
1 Nr. 1 wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft, wer Betäubungsmittel unerlaubt anbaut, herstellt oder mit ihnen
Handel treibt (§ 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) und dabei als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten
verbunden hat. Gemäß § 30a Abs. 1 wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft, wer Betäubungsmittel in nicht geringer
Menge unerlaubt anbaut, herstellt, mit ihnen Handel treibt, sie ein- oder ausführt (§ 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) und dabei als Mitglied
einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat.
Wenn Gerichte den Tatbestand eines Handelns innerhalb einer Bande anerkennen und für bewiesen erachten, dann handelt
es sich meistens um minderschwere Fälle, die vorwiegend von Jugendlichen begangen wurden Der Begriff der Bande ist nämlich definiert
als Zusammenschluß von mindestens drei Personen, die sich mit dem Willen verbunden haben, künftig für eine gewisse Dauer mehrere
selbständige, im einzelnen noch ungewisse Straftaten des im Gesetz genannten Deliktstyps zu begehen. Die Mitglieder der Bande können
in der Bande ihre eigenen Interessen an einer risikolosen und effektiven Tatausführung und Beute- oder Gewinnerzielung verfolgen. Danach
unterscheidet sich die Bande von der Mittäterschaft durch das Element der auf eine gewisse Dauer angelegten Verbindung mehrerer Personen
zu zukünftiger gemeinsamer Deliktsbegehung. Mitglied einer Bande kann auch sein, wem nach der – stillschweigend möglichen – Bandenabrede
nur Aufgaben zufallen, die sich bei wertender Betrachtung als Gehilfentätigkeiten darstellen. 47  Die hier dargestellte heute Rechtsgültige
Auffassung des Bundesgerichtshofes wurde bis zum März 2001 vom Generalbundesanwalt angefochten. Dieser wollte den Begriff in erweiterter
Form definiert wissen, insbesondere vertrat er die Ansicht, daß bereits zwei Personen als Bande definiert werden können, was in der
Rechtspraxis bis zum Jahr 2001 auch von einigen Gerichtsinstanzen so gesehen wurde. Aufgrund dieser Tatsache sind angegebene Zahlen
zur Häufigkeit des Vorkommens von Bandenkriminalität aus den Jahren vor 2001 mit denen aus den Jahren nach 2001 nur bedingt miteinander
vergleichbar. Die hier dargestellte heute Rechtsgültige
Auffassung des Bundesgerichtshofes wurde bis zum März 2001 vom Generalbundesanwalt angefochten. Dieser wollte den Begriff in erweiterter
Form definiert wissen, insbesondere vertrat er die Ansicht, daß bereits zwei Personen als Bande definiert werden können, was in der
Rechtspraxis bis zum Jahr 2001 auch von einigen Gerichtsinstanzen so gesehen wurde. Aufgrund dieser Tatsache sind angegebene Zahlen
zur Häufigkeit des Vorkommens von Bandenkriminalität aus den Jahren vor 2001 mit denen aus den Jahren nach 2001 nur bedingt miteinander
vergleichbar.
Dem Bundesgerichtshof wurden die beiden folgenden Fragen zur Klärung vorgelegt:
- Setzt der Begriff der Bande eine Verbindung von mehr als zwei Personen voraus?
- Erfordert der Tatbestand des Bandendiebstahls das zeitliche und örtliche Zusammenwirken von (mindestens) zwei
Bandenmitgliedern?
Der Generalbundesanwalt war zur ersten Vorlegungsfrage der Auffassung, es seien keine Gründe von Gewicht erkennbar,
die Anlaß geben könnten, die gefestigte Rechtsprechung aufzugeben, daß die Verbindung von zwei Personen genügt, um die Anforderungen
eines Bandendelikts zu erfüllen. Hinsichtlich der zweiten Vorlegungsfrage vertrat er die Auffassung, daß der Tatbestand des Bandendiebstahls
kein örtliches und zeitliches Zusammenwirken von wenigstens zwei Bandenmitgliedern erfordere. Dies werde weder vom Gesetzeswortlaut vorgegeben,
noch sei dies aus anderen zwingenden Gründen geboten. Dem Erfordernis der Mitwirkung eines anderen Bandenmitglieds sei Genüge getan,
wenn ein Bandenmitglied am Wegnahmeort tätig werde und ein irgendwie geartetes Zusammenwirken beim Diebstahl mit einem anderen Bandenmitglied
hinzukomme.
Der Generalbundesanwalt hatt deshalb beantragt zu beschließen:
- Der Begriff der Bande setzt eine Verbindung von mehr als zwei Personen nicht voraus.
- Der Tatbestand des Bandendiebstahls erfordert nicht, daß mindestens zwei Bandenmitglieder die Tat in örtlichem und zeitlichem
Zusammenwirken begehen.
Der Große Senat für Strafsachen beantwortete die vorgelegten Rechtsfragen wie aus der Entscheidungsformel ersichtlich.
"I. Zum Bandenbegriff
Der Begriff der Bande setzt den Zusammenschluß von mindestens drei Personen voraus, die sich
mit dem Willen verbunden haben, künftig für eine gewisse Dauer mehrere selbständige, im einzelnen noch ungewisse Straftaten des im
Gesetz genannten Deliktstyps zu begehen. Ein "gefestigter Bandenwille" oder ein "Tätigwerden in einem übergeordneten Bandeninteresse"
ist nicht erforderlich.
Der Tatbestand des Bandendiebstahls (§ 244 Abs. 1 Nr. 2 StGB) schreibt, wie die anderen Vorschriften des
Strafgesetzbuchs und des Nebenstrafrechts, die an das Merkmal der bandenmäßigen Begehung anknüpfen, keine Mindestzahl vor, ab der
ein Zusammenschluß von Personen zu kriminellem Tun als eine Bande anzusehen ist. Nach der ständigen Rechtsprechung genügte für den
Begriff der Bande eine auf einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Vereinbarung beruhende Verbindung von mindestens zwei Personen,
die sich mit dem ernsthaften Willen zusammengeschlossen haben, für eine gewisse Dauer in Zukunft mehrere selbständige, im einzelnen
noch unbestimmte Taten eines bestimmten Deliktstyps zu begehen (BGHSt 23, 239; 38, 26, 31; BGH bei Dallinger MDR 1973, 555; BGH StV
1984, 245; NStZ 1986, 408; BGHR StGB § 250 Abs. 1 Nr. 4 Bande 1); für eine Bande war weder eine gegenseitige Verpflichtung der Mitglieder
zur Begehung solcher Delikte noch die Bildung einer festen Organisation vorausgesetzt (BGHSt 31, 203, 205; 42, 255, 258, BGH GA
1974, 308; BGH bei Holtz MDR 1977, 282).
Der so umschriebene Bandenbegriff wird in weiten Teilen des Schrifttums seit vielen Jahren abgelehnt (vgl. etwa
Dreher NJW 1970, 1802; Tröndle GA 1973, 325, 328; Geilen Jura 1979, 445, 446; Schünemann JA 1980, 393, 395; Schild NStZ 1983, 69,
70). Die Einwände verstärkten sich nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer
Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität (OrgKG) vom 15. Juli 1992 (BGBl. I S. 1302), mit dem, ohne die Bande gesetzlich
zu definieren, neue Bandendelikte geschaffen (§ 260 Abs. 1 Nr. 2, § 260 a Abs. 1 StGB) und die Strafdrohung bereits vorhandener
Bandendelikte unter bestimmten weiteren Voraussetzungen verschärft wurden (§ 244 a Abs. 1 StGB, § 30 a Abs. 1 BtMG). Der Annahme,
der Zusammenschluß von zwei Personen genüge für eine Bande, wird von der überwiegenden Meinung in der Literatur hauptsächlich
entgegengehalten, daß eine Willensbildung als gruppendynamischer Prozeß erst innerhalb einer größeren Gruppe entstehe und die
Gefährlichkeit einer Bande erst bei mehr als zwei Mitgliedern unabhängig vom Aus- oder Hinzutreten einzelner Mitglieder gegeben
sei (so in jüngster Zeit Erb NStZ 1999, 187; Endriß StV 1999, 445; Otto StV 2000, 313; Engländer JZ 2000, 630; Hohmann NStZ 2000,
258; Schmitz NStZ 2000, 477).
Trotz der erheblichen Kritik am herkömmlichen Bandenbegriff hat die Rechtsprechung bisher keinen Anlaß gesehen, ihre Definition
der Bande zu ändern; sie hat es auch nicht für gerechtfertigt gehalten, den vom Bundesverfassungsgericht (NJW 1997, 1910, 1911)
gebilligten Begriff der Bande durch das Erfordernis organisatorischer Strukturen restriktiv auszulegen (BGH StV 1997, 592, 593;
BGHR BtMG § 30 a Bande 3). Da auch nach Auffassung der Rechtsprechung die bandenmäßige Tatbegehung eine gegenüber der Mittäterschaft
gesteigerte, über die aktuelle Tat tendenziell hinausreichende deliktische Zusammenarbeit darstellt, hat sie - insbesondere bei
Verbindung von zwei Personen – aber zusätzlich verlangt, daß die Täter eines Bandendelikts ein gemeinsames übergeordnetes Bandeninteresse
verfolgt haben (BGHSt 42, 255, 259; BGH NStZ 1997, 90, 91; 1998, 255 m. Anm. Körner; BGHR BtMG § 30a Bande 8). Sie hat zur Abgrenzung
der Bande von der mittäterschaftlichen Arbeitsteilung darauf abgestellt, ob ein über die jeweiligen Individualinteressen der Beteiligten
hinausgehender gefestigter Bandenwille vorgelegen hat (BGH NJW 1996, 2316, 2317). Dazu hat sie Kriterien zu entwickeln versucht,
mit deren Hilfe der Begriff der Bande inhaltlich näher umschrieben und konkreter gefaßt werden sollte. Als Voraussetzung für die
Annahme einer Bande bei Zwei-Personen-Verbindungen verlangten zuletzt alle Strafsenate des Bundesgerichtshofs ein Handeln mit
gefestigtem Bandenwillen, wobei ein solcher, auf gewisse Dauer angelegter und verbindlicher Gesamtwille dann angenommen wurde,
wenn die Täter ein gemeinsames übergeordnetes Bandeninteresse verfolgt hatten (BGH NStZ 1996, 443; 2001, 32, 33; NJW 1998, 2913;
StV 1998,599).
Diese in jüngerer Zeit entfalteten Bemühungen der Rechtsprechung um die Entwicklung sinnvoller und praktikabler
Kriterien, die vor allem bei Zwei-Personen-Verbindungen eine dem Einzelfall gerecht werdende Abgrenzung von bandenmäßigen und anderen
Zusammenschlüssen erlauben sollen, haben zu neuen Schwierigkeiten bei der Auslegung geführt. Sie rücken die Bandentat in die Nähe
des Organisationsdelikts der kriminellen Vereinigung des § 129 StGB, obwohl die Bandendelikte, auch nach den Entscheidungen, die
von der Notwendigkeit eines verbindlichen Gesamtwillens und der Verfolgung eines übergeordneten Bandeninteresses ausgehen, keine
Organisationsdelikte sind (vgl. BGHSt 42, 255, 258; BGH NStZ 1996, 339, 340; BGHR BtMG § 30 a Bande 9).
Hinzu kommt, daß es bisher nicht gelungen ist, die materiellrechtlichen Voraussetzungen eines "auf gewisse Dauer angelegten gefestigten
Bandenwillens" oder des "übergeordneten Bandeninteresses" konkret zu umschreiben und rechtliche Maßstäbe festzulegen, die es den
Tatgerichten ohne weiteres ermöglichen, im Einzelfall unter Berücksichtigung der höchstrichterlichen Rechtsprechung zu prüfen
und zu entscheiden, ob ein Zusammenschluß von zwei Personen eine Bande darstellt (vgl. Tröndle/Fischer, StGB 50. Aufl. § 244
Rdn. 19 a; Franke/Wienroeder, BtMG 2. Aufl. § 30 Rdn. 8).
Die wenig befriedigenden Lösungsversuche der Rechtsprechung verlangen ein Überdenken der materiellrechtlichen
Voraussetzungen einer Bande.
Dies gilt verstärkt deshalb, weil das ursprünglich homogene Bild weniger Bandendelikte – Bandendiebstahl, Bandenraub und bandenmäßiger
Schmuggel –, die aufgrund ihrer geringen Anzahl in ihrem gemeinsamen Regelungsbereich, nämlich dem bandenmäßigen Zusammenschluß
und der bandenmäßigen Tatbegehung, überschaubar und in bezug auf die rechtlichen Voraussetzungen in sich stimmig festzulegen waren,
nicht mehr besteht. Die genannten Bandendelikte sind mittlerweile durch eine Vielzahl von verschiedenen Straftatbeständen ergänzt
worden, in denen die bandenmäßige Begehung entweder als tatbestandliches Qualifikationsmerkmal oder als Regelbeispiel eines besonders
schweren Falles aufgeführt wird. Hierdurch sind die ehemals aus der Menge der Straftatbestände hervorgehobenen Bandendelikte zu
Delikten der modernen Massenkriminalität abgewandelt worden (vgl. Hassemer StV 1993, 664).
Angesichts der fehlgeschlagenen Bemühungen der Rechtsprechung, unter Beibehaltung der Verbindung
von zwei Personen als Mindestvoraussetzung für eine Bande den Bandenbegriff durch zusätzliche Kriterien inhaltlich näher zu bestimmen,
ist es sinnvoll und geboten, für eine Bande den Zusammenschluß von mindestens drei Personen zu kriminellem Tun vorauszusetzen.
Der Wortlaut des § 244 Abs. 1 Nr. 2 StGB und der Wortlaut der übrigen Tatbestände der Bandendelikte lassen sowohl die Annahme
einer aus zwei Personen bestehenden Bande als auch die Anhebung der Mindestzahl der Bandenmitglieder auf drei Personen zu. Diese
Erhöhung der Mindestmitgliederzahl ist ein einfaches und erfolgversprechendes Mittel, um die Abgrenzung der wiederholten
gemeinschaftlichen Tatbegehung durch Personen, die nur Mittäter sind, von derjenigen der bandenmäßigen Begehung zu vereinfachen.
Sie erleichtert die Abgrenzung vor allem auch in der praktischen Rechtsanwendung durch die Tatgerichte, da Zwei-Personen-Zusammenschlüsse
von vornherein nicht mehr dem Bandenbegriff unterfallen. Die Anhebung der Mindestmitgliederzahl einer Bande von zwei auf drei
dient damit der Rechtssicherheit und der einheitlichen Rechtsanwendung. Zu einer weiteren Einschränkung des Bandenbegriffs besteht kein Anlaß. Insbesondere bieten
die Entstehungsgeschichte und die Gesetzesmaterialien des OrgKG und der nachfolgenden Reformgesetze keinen Anhalt dafür, daß der
Gesetzgeber die Bande als eine kriminelle Erscheinungsform mit einem Mindestmaß konkreter Organisation oder festgelegter Strukturen
verstanden hat und verstanden wissen wollte (vgl. BT-Drucks. 12/989 S. 20 f., 25). Er hat die Bande lediglich als mögliche Keimzelle
der Organisierten Kriminalität gesehen und als Anknüpfungsmerkmal für erhöhte Strafdrohungen gewählt, indem er die schon im Strafgesetzbuch
vorhandenen Merkmale der "gewerbsmäßigen" und "bandenmäßigen" Tatbegehung als besonders "organisationsverdächtig" aufgegriffen hat (vgl.
Begründung zum Gesetzentwurf des Bundesrats vom 26. April 1991 - BR-Drucks. 219/91 S. 78). In diesem Zusammenhang sollte der Begriff
der Bande nicht (neu) definiert werden. Es ist mit der früheren Rechtsprechung davon auszugehen, daß ein bandenmäßiger Zusammenschluß
mehrerer Personen lediglich voraussetzt, daß diese sich mit dem Willen verbunden haben, künftig für eine gewisse Dauer mehrere
selbständige im einzelnen noch ungewisse Straftaten der im Gesetz beschriebenen Art zu begehen.
Die Bande unterscheidet sich danach von der Mittäterschaft durch das Element der auf eine gewisse Dauer angelegten Verbindung
mehrerer Personen zu zukünftiger gemeinsamer Deliktsbegehung. Von der kriminellen Vereinigung unterscheidet sich die Bande dadurch,
daß sie keine Organisationsstruktur aufweisen muß und für sie kein verbindlicher Gesamtwille ihrer Mitglieder erforderlich ist,
diese vielmehr in einer Bande ihre eigenen Interessen an einer risikolosen und effektiven Tatausführung und Beute- oder Gewinnerzielung
verfolgen können.
Der Änderung der Rechtsprechung zur Mindestzahl der Bandenmitglieder steht nicht der Umstand
entgegen, daß der Gesetzgeber bei den Änderungen des materiellen Strafrechts den in der Rechtsprechung entwickelten Bandenbegriff
zugrundegelegt hat.
Zwar läßt sich aus den Gesetzesnovellierungen der letzten Jahrzehnte eine gesetzgeberische Bestätigung des von der Rechtsprechung
definierten Bandenbegriffs ableiten (vgl. BGHSt 38, 26, 28; Wessels/Hillenkamp BT/2, 23. Aufl. § 4 III 1 Rdn. 271; Sya NJW 2001,
343, 344). Hingegen ist eine gesetzliche Festlegung oder Umschreibung des Bandenbegriffs, etwa in § 11 StGB, unterblieben, obwohl
dem Gesetzgeber die seit mehr als 30 Jahren kontrovers geführte Diskussion zum Bandenbegriff nicht entgangen sein kann. Damit hat
er es ersichtlich weiter der Rechtsprechung überlassen, den Begriff der Bande inhaltlich zu bestimmen; er hat ihr damit auch die
Möglichkeit eingeräumt, Entwicklungen in der Rechtspraxis Rechnung zu tragen, wenn es zur Gewährleistung der Rechtssicherheit oder
der einheitlichen Rechtsanwendung erforderlich ist.
[...]"
Vor dem Hintergrund, daß bis zu diesem Entscheid des Bundesgerichtshofes bereits zwei Personen eine Banden bilden
konnten und nach diesem Entscheid die Feststellung rechtsverbindlich war, daß es keinen Anhalt dafür geben muß, daß die Bande mit einem
Mindestmaß konkreter Organisation oder festgelegter Strukturen verbunden sein muß und zudem, daß ein bandenmäßiger Zusammenschluß mehrerer
Personen lediglich voraussetzt, daß diese sich mit dem Willen verbunden haben, künftig für eine gewisse Dauer mehrere selbständige
im einzelnen noch ungewisse Straftaten der im Gesetz beschriebenen Art zu begehen, ist die Zahl der bandenmäßig erfaßten Delikte außerordentlich
gering, wie aus den folgenden Graphiken Nr. 30 und Nr. 31 entnommen werden kann.
Graphik 30: Erfaßte Delikte – Zeitreihe: Anteil organisierte Bandenkriminalität in Prozent
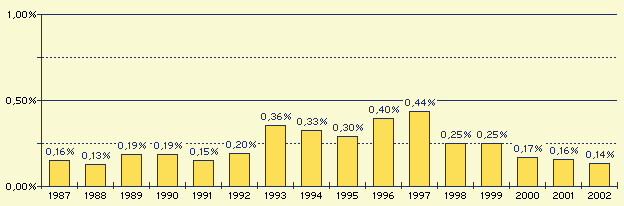
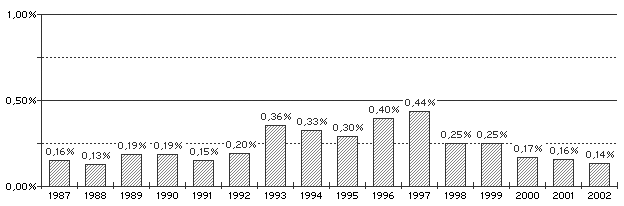
Berechnet auf Basis der Daten von: BKA: PKS Zeitreihe 1987 bis 2002, Wiesbaden 2003, Tab. 1, Schlüsselzahlen 7300 und
7342
Im Jahr 2002 (2001) wurden von 250.969 (246.518) erfaßten Delikten nur 339 (396) als Bandendelikte registriert.
Graphik 31: Tatverdächtige – Zeitreihe: Anteil organisierte Bandenkriminalität in Prozent
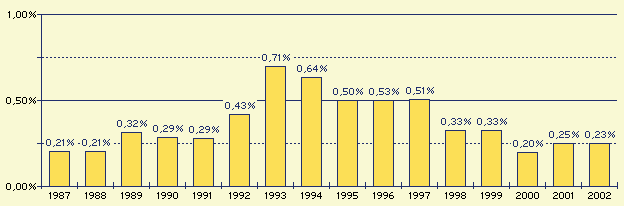
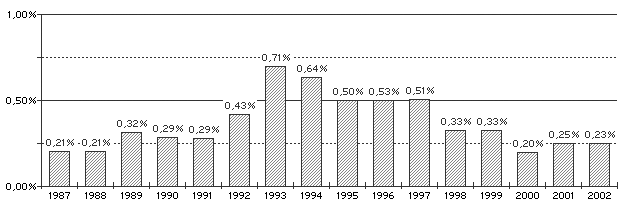
Berechnet auf Basis der Daten von: BKA: PKS Zeitreihe 1987 bis 2002, Wiesbaden 2003, Tab. 20, Schlüsselzahlen
7300 und 7342
Im Jahr 2002 (2001) wurden von 205.962 (202.281) erfaßten Tatverdächtigen gerade einmal 466 (496) als
Bandenmitglieder registriert.
|